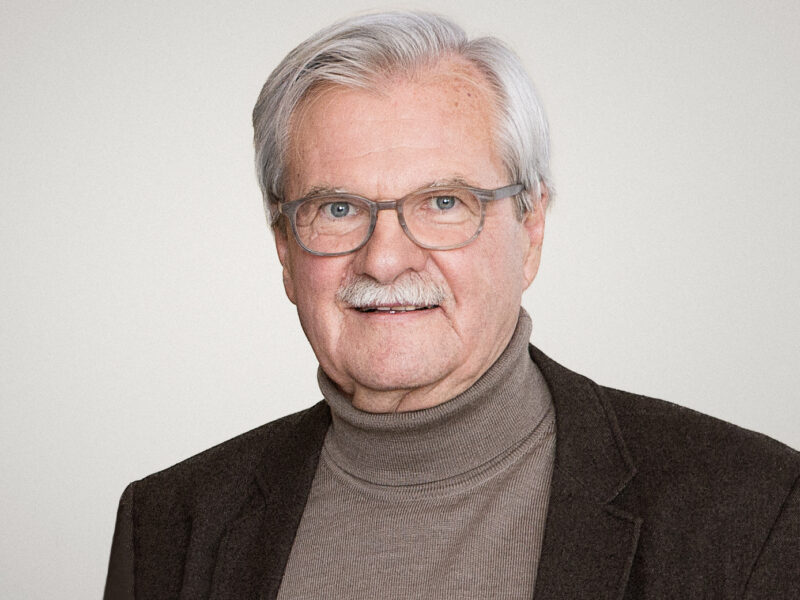Psychische Verletzbarkeit zeichnet den um sich selbst wissenden Menschen aus. Sie zeugt davon, dass der Mensch nicht in sich eingeschlossen ist, sondern zwischenmenschlich offen ist. Ohne diese Zwischenmenschlichkeit, die auch eine Zwischenleiblichkeit voraussetzt, hätte sich der Mensch nie kulturell so weit entwickeln können, wie es ihm evolutionär möglich war.
Verletzlichkeit ist weder Defizit noch Schwäche – sie gehört zum Menschen und charakterisiert ihn. Sie kann den Menschen sowohl gefährden wie auch weiterbringen. Gerade wenn die positive Seite der Verletzbarkeit betont werden soll, darf die negative nicht unerwähnt bleiben. So kann ein Mensch infolge psychischer Verletzungen oder Kränkungen psychisch erkranken. Er kann aber auch Mitmenschen psychisch verletzen, um von der eigenen Verletzlichkeit abzulenken oder sich über den anderen hinwegzusetzen. Umso wichtiger ist ein hilfreicher Umgang mit der menschlichen Verletzbarkeit. Es geht darum, ihre positiven Seiten zu fördern. Dazu gehören Offenheit und Mitgefühl sowie persönliches Wachstum.
Wer seine äussere Verletzlichkeit und seine innere Fragilität nicht verdrängt, sondern als Teil der menschlichen Existenz annimmt, kann Krisen besser überwinden. Er kann mit eigenen Wunden und Brüchen fürsorglicher umgehen, auch weil er nicht beweisen muss, wie stark er ist. Er kann authentische Nähe besser zulassen – im persönlichen, therapeutischen und gesellschaftlichen Kontext.
Aber auch wenn sich jemand bewusst ist, wie grundlegend die zwischenmenschliche Offenheit für die persönliche Entwicklung und die Gemeinschaftsbildung ist, wird es ihm manchmal trotzdem schwerfallen, eine schmerzhafte psychische Verletzung hinzunehmen. Ist die Verletzung Folge eines aggressiven Aktes, so wird er sie erst recht nicht gutheissen können. Das macht es aber schwieriger, die Wunde anzunehmen und sie sorgsam zu pflegen. Solange ich meine seelische Wunde in Zusammenhang mit einem Aggressor bringe, hat sie tendenziell den Charakter eines Fremdkörpers. Dann gehört sie nicht ganz mir. Das ist der besonders «böse» Aspekt einer kränkenden (das heisst auch krank machenden) Aggression, dass sie den verletzten Menschen punktuell entfremdet.
Umso wichtiger ist die klare Trennung zwischen verletzendem Akt und Wunde. Die seelische Wunde gehört mir, auch wenn sie mir übel angetan wurde und wenn sie weiter schmerzempfindlich ist, insbesondere wenn ich daran «rühre» oder jemand daran «rührt». Ihr Heilungsprozess wird aber erleichtert, wenn ich sie sorgfältig und einfühlend als meine Wunde behandle. Ich bin nicht Opfer der Wunde, sondern Opfer eines verletzenden Menschen. Nur ist diese Einsicht nicht immer einfach umzusetzen.
Umso wichtiger ist eine mitmenschliche Unterstützung, die seelisch verletzte Menschen spüren lässt, dass sie gemeinschaftlich eingebettet sind und ihre menschliche Vulnerabilität und Fragilität nicht nur Verletzungen, sondern vor allem auch Zuwendung und Empathie ermöglicht. Dann ist es für verletzte Menschen leichter, ihre seelische Verletzung zu verschmerzen und sich aus Verkrampfung und einer allfälligen Opferhaltung zu lösen.
Literaturempfehlungen:
- Hell D. (2022). Selbst in der Krise – Krise des Selbst. Schwabe Verlag, Basel.
- Hell D. (2021). Lob der Scham: Nur wer sich achtet, kann sich schämen. Psychosozial.
- Largo R. (2018). Das passende Leben. Was unsere Individualität ausmacht und wie wir sie leben können. Fischer, Berlin.
- Diederich und Zyrfas. Glossar der Vulnerabilität. Springer.