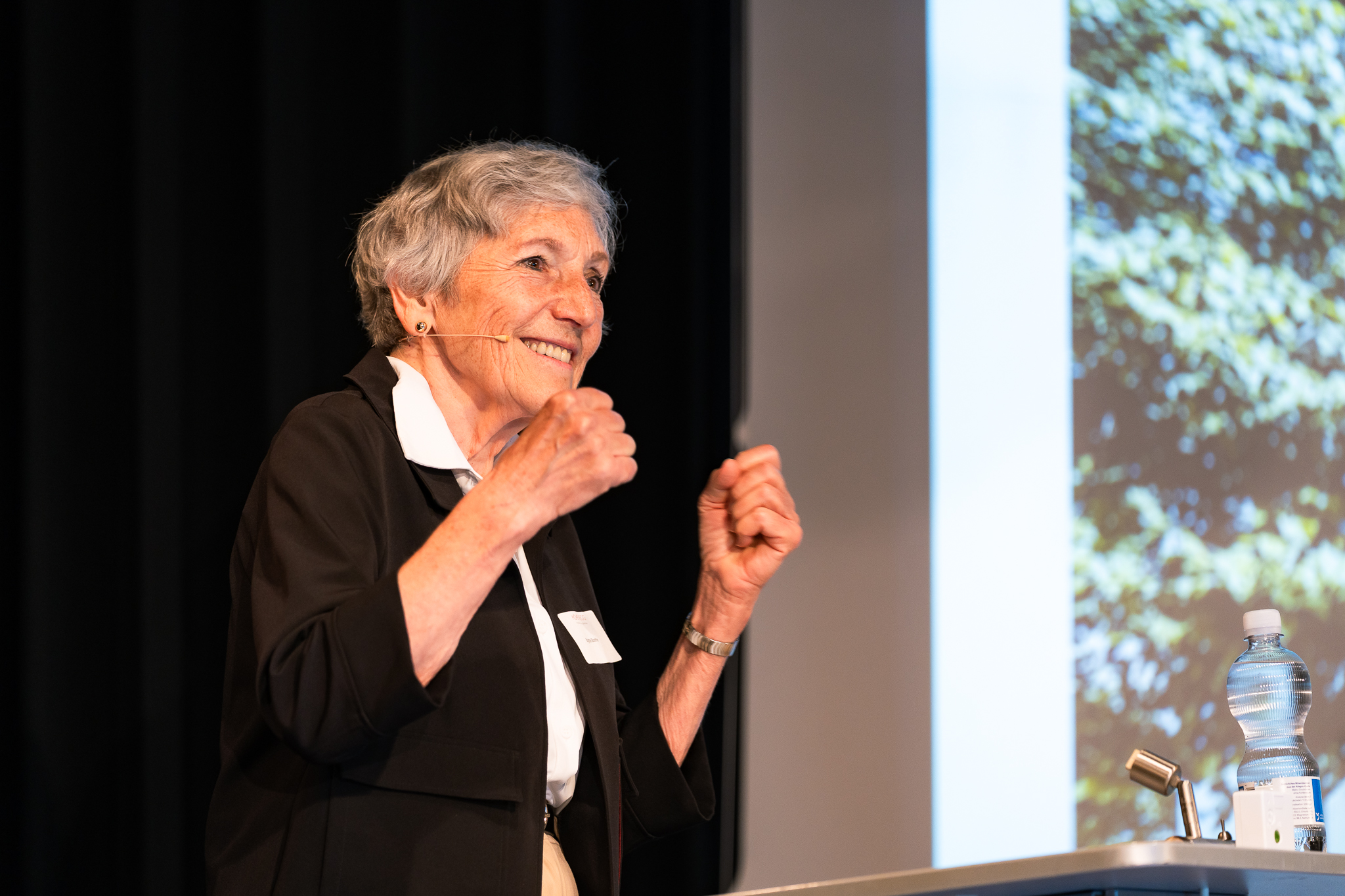Ist die Diagnose «Narzissmus» verletzend? Vielleicht ja. «Du bist narzisstisch» soll eine der letzten salonfähigen Beleidigungen sein. Man verteilt sie gern und häufig. Foren im Internet bieten Gelegenheit zum Austausch über den Narzissmus der Anderen, aber sogar, im seltenen Fall, für Einzelne, die sich selbst als narzisstisch sehen. Narzissmus gehört zum Allerweltsjargon. Du bist egozentrisch, zynisch, manipulativ: Das mögen Adressaten mit kühler Verachtung quittieren. Denn Personen mit offensiver Selbstprofilierung bei imperativem Souveränitätsgebaren lassen sich nicht verletzen. Sie sind vielmehr vulnerant, verletzend. Eine ausgeprägte Selbstzentrierung vermittelt sich in dem, was man als «narzisstische» Moral, als das Recht des Stärkeren oder, mit Friedrich Nietzsche, als «Herrenmoral» beschreiben kann. Was gut ist, bestimmt der Herr. Das entspricht der Haltung des Verachtens, Entwertens, Blossstellens oder Erniedrigens.
Grössenphantasien und Selbstzentrierung sind verdeckt auch bei scheu vulnerabler Haltung gegeben, die Imponiergehabe und Siegesposen vermeidet und durch Kleinheitsphantasien auffällt. Hier regiert die defensive Selbstverkleinerung bei ausgeprägter Verletzlichkeit, Kränkbarkeit und Beschämungsangst. Und auch hier herrscht die «Herrenmoral»: Denn immer noch misst sich die Person an übersteigerten Grössenfantasien und sieht sich einem gnadenlosen Regime der Selbstverwerfung preisgegeben.
Therapeutinnen und Therapeuten sollen der seelischen Welt ihrer Patientinnen und Patienten mit unvoreingenommener Aufmerksamkeit und in der Haltung wohlwollender Rezeptivität begegnen. Leicht gesagt, schwer getan. Gerade bei Personen, die als narzisstisch eingeschätzt werden, sind Geringschätzung, Entwertung, Verachtung oder Zynismus sowohl für Therapeutinnen und Therapeuten als auch für Patientinnen und Patienten gravierende Beziehungsrisiken. Kann man dieser massiven emotionalen Herausforderung überhaupt konstruktiv begegnen? Es empfiehlt sich, den Ratsuchenden genau zuzuhören, denn so eröffnet sich die Perspektive der ersten Person. So kann man sich auf das persönliche Bezugssystem der Patientinnen und Patienten einstellen. Man sei beim Zuhören offen für das Nicht-Gesagte und für das schwer Sagbare. Besondere Aufmerksamkeit sollte die Erfassung des Anliegens der Ratsuchenden haben: Was sind Gründe, therapeutische Hilfe zu suchen? Was sind verdeckte, in der Latenz zu erschliessende Gründe des Kommens? Therapeutische Kommunikation verlangt von beiden die Fähigkeit, das Persönliche als bedeutsam zu erachten und dies auch im Gespräch zu artikulieren. Das hat im Kontext des Narzissmus ganz zentrale Bedeutung: Die Abwehrmassnahmen des Verachtens, Entwertens, Verleugnens, Verwerfens haben negativen Einfluss auf die Selbstwahrnehmung und den Selbstbezug: Alles, was nicht zum Bild der Unverwundbarkeit passt, wird ausgeblendet. Narzissmus verhindert Selbstkenntnis.
Wenn es in der therapeutischen Beziehung gelingt, der Vielgestaltigkeit und dem Facettenreichtum des Emotionalen, der Körperlichkeit und der Welt des Erlebens Aufmerksamkeit und Sprache zu schenken, ist das ein grosser Schritt. Dann ist man nicht mehr unverwundbarer Ritter in unzerstörbarer Rüstung, dann beginnt das Leben zu schmecken.
Literaturempfehlungen (Zusammenfassungen zu diesen Werken finden Sie untenstehend):
- Boothe, B. (2015). Weiblicher Narzissmus. Ärztliche Psychotherapie und Psychosomatische Medizin 10. S. 81-84.
- Jolles, A. (1968). Naive Moral (aus: André Jolles, Einfache Formen: Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch…. Max Niemeyer Verlag, Tübingen.
- Lammers, C.-H. (2023). Wie man eine narzisstische Störung erfolgreich therapieren kann. https://www.hogrefe.com/ch/thema/wie-man-eine-narzisstische-stoerung-erfolgreich-therapieren-kann
- Neukom, M. (2024). Narzissmus im Arbeitsleben. Selbstbezogenheit verstehen statt stigmatisieren. Vandenhoek & Ruprecht, Gö
- Zweig, S. (1939). Ungeduld des Herzens. Bermann-Fischer/Allert de Lange, Stockholm/Amsterdam.