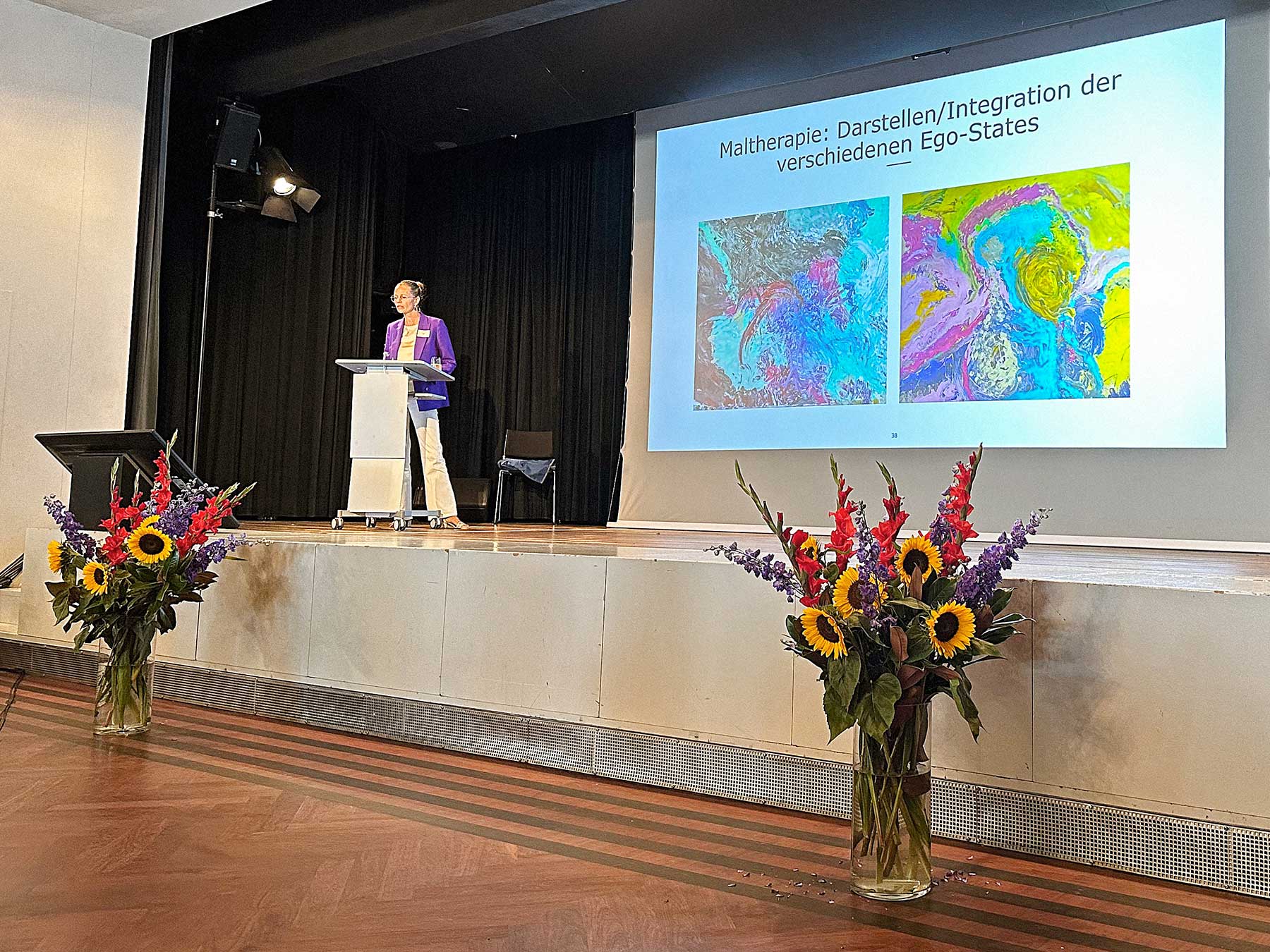Der Ärztliche Direktor Prof. Dr. med. univ. Josef Jenewein und Dr. med. Katrin Merz führten durch die Veranstaltung. In ihrer Begrüssung und im Einführungsreferat zeigten sie die Relevanz und Bedeutung des Themas Resilienz für Gesellschaft, Individuum und Klinik auf.
Jeder Mensch wird im Laufe seines Lebens eine Krise, einen Verlust, eine Erschütterung, ein Trauma oder eine Kränkung erleben. Nicht jeder aber, der eine Krise durchlebt, wird psychisch krank. Was macht Menschen widerstandsfähig, und wie können sie sich in schwierigen Zeiten helfen?
Prof. Dr. med. Undine Lang, Professorin für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Basel, zeigte in ihrem Referat auf, wie wichtig neben dem Bekämpfen von Symptomen das Stärken von Ressourcen ist. «Resilienz ist lernbar und setzt sich aus vielen Faktoren zusammen, die uns helfen, Krisen zu überwinden.»
Gedanken können die Psyche massiv belasten. Während Menschen ihren Alltagsaktivitäten nachgehen, verbringen sie etwa 50% der Zeit mit anderen Gedanken. «Um resilienter zu werden, ist es unerlässlich, sich trotz negativer Gedanken oder Gefühle mit dem Leben und der Realität zu verbinden. Nur so können wir positive Gefühle erleben», so Undine Lang.
Die Klinikdirektorin unterstrich in Bezug auf Resilienz die Bedeutung von Dankbarkeit, positiven Emotionen, Freude, Liebe, Neugier, Humor, Gelassenheit, Motivation und Optimismus. «Sie führen zu einer Verbesserung von Gesundheit, Beziehungen und Lebenszufriedenheit.»
Schliesslich zeigte Undine Lang lang auf, dass unterschiedliche Aktivitäten und Verhaltensweisen vor psychischen Erkrankungen schützen: Yoga, Meditation, das Pflegen von Hobbys und Freundschaften, gesunde Schlafgewohnheiten, ein wertschätzendes Arbeitsklima sowie eine nachhaltige Ernährung.
Dr. med. Sabine Röcker und Dr. biol. hum. Fiona Witte, beide an der Privatklinik Hohenegg tätig, gaben in ihrem Vortrag einen praxisorientierten Einblick in die Arbeit mit Patientinnen und Patienten mit Traumafolgestörungen.
Sie erläuterten anschaulich Struktur, Regeln und Setting einer Resilienzgruppe: Achtsamkeitsbasierte Körperübungen und Atemübungen verbessern die Selbstwahrnehmung und Emotionsregulation von Patientinnen und Patienten. Es gehe immer auch darum, Sicherheit zu vermitteln und das Aktivieren von Ressourcen zu fördern. «Es handelt sich um Hilfe zur Selbsthilfe. Das Ziel ist, die Autonomie der Patientinnen und Patienten zu steigern», erläuterten die beiden Fachfrauen.
Von Bedeutung sei immer auch die Psychoedukation zu Fragen der Resilienz, der Traumatherapie und den Traumafolgen. «Psychoedukation hat das Ziel, den Betroffenen durch das Verständnis ihrer Symptomatik und der therapeutischen Massnahmen Sicherheit, Kompetenzerleben und Kontrolle zu vermitteln.» Die traumatischen Erlebnisse der Teilnehmenden hingegen würden nicht in der Gruppe besprochen, sondern in der Einzeltherapie. Schliesslich seien Beziehungen ein wesentlicher Resilienzfaktor, so Sabine Röcker und Fiona Witte. «Die Gruppe ermöglicht Patientinnen und Patienten, sich auszutauschen und zu erfahren, dass sie mit ihrem Erleben, ihren Ängsten und ihrer Vulnerabilität nicht allein sind.»
Univ.-Ass. Lukas Repnik, Doktorand an der Medizinischen Universität Graz, gab einen Einblick in die aktuelle Resilienzforschung. Er präsentierte verschiedene Resilienz-Konzepte und psychometrische Verfahren, mit denen Resilienz messbar und vergleichbar ist. Dabei zeigt sich, dass die einzelnen Konzepte sehr unterschiedlich sind, am häufigsten ist Resilienz aber mit verschiedenen Persönlichkeitsfaktoren wie Optimismus, Offenheit, Extraversion usw. assoziiert.
Im vierten Referat zeigte Prof. Dr. Guy Bodenmann, Professor für Klinische Psychologie an der Universität Zürich beispielhaft auf, was Paare stark macht. Es seien nicht Intelligenz, Schönheit oder Sexappeal, welche den Ausschlag gäben, sondern Commitment, emotionale Selbstöffnung und gegenseitige Unterstützung. Es seien zudem nicht die Paare, die nie streiten, die längerfristig glücklich bleiben, sondern diejenigen, die Störendes konstruktiv ansprechen. Und: «Für ein glückliches Miteinander braucht es die kleinen Gesten, die gegenseitige Unterstützung, das offene Gespräch und das Bekenntnis zueinander.»
Dr. med. Bernadette Ruhwinkel, Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Alterspsychotherapie, sprach über «Resilienz, die etwas andere Altersvorsorge». Für die Ärztin ist Resilienz «die Kunst zu wachsen und unter widrigen Umständen seine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren». In ihrem Vortrag skizzierte sie die Faktoren, die Resilienz fördern: Akzeptanz, Selbstwirksamkeit, Lösungs- und Zielorientierung, Eigenverantwortung, Endlichkeit und Beziehungen leben. Es sei wichtig, sich da einzubringen, wo man wirksam sein könne. Die Psychotherapeutin betonte, wie wichtig es sei zu lernen, Gedanken, Handeln und die eigene Wahrnehmung bewusst einzusetzen. Und sie fragte: «Lasse ich mich von meiner Wut und meiner Angst leiten oder von dem, was die anderen möglicherweise von mir erwarten? Oder gehe ich meinen eigenen Weg, Schritt für Schritt?»
Bernadette Ruhwinkel schilderte zudem, wie wichtig es ist, sich der eigenen Krisenkompetenz bewusst zu werden und persönliche Lösungsstrategien zu entwickeln. Schliesslich betonte die Referentin die Relevanz von Zielen im Alter. «Wie will ich reifen, und wohin will ich wachsen? Vermag ich meinem Leben Sinn zu verleihen? Setze ich mich für das ein, was mir wirklich wichtig ist?» Wie die anderen Referenten hob auch Ruhwinkel die Wichtigkeit von Beziehungen und Optimismus hervor. «Wir sollten Beziehungen bewusst gestalten und das Beste aus dem machen, was ist.»
Dr. med. Adrian Dubs vom Spital Männedorf und Dr. med. Ruedi Schweizer, tätig am Zentrum für psychische Gesundheit der Privatklinik Hohenegg und an den Spitälern Männedorf und Zollikerberg, widmeten sich in ihrem Vortrag dem Thema «Resilienz und Psychoonkologie: Krebs bewältigen – geht das? Resilienz aus (psycho-) onkologischer Perspektive». Sie fragten, ob es Hoffnung gebe im Kampf gegen Tumorerkrankungen und ob diese Hoffnung aus psychoonkologischer Sicht bedeutsam sei. Ruedi Schweizer führte aus: «Wir sind grundsätzlich dankbar, wenn Hoffnung dazu beiträgt, sich besser zu fühlen. Häufig sind wir und die Patienten besonders herausgefordert, wenn uns der Onkologe verkündet, dass zur Hoffnung wenig Anlass bestehe. Sollen wir mit dem Patienten einen Realitätsabgleich durchführen oder ihn in seiner Wahrnehmung stärken? Das ist dann die Frage.»
Der Umgang mit einer Krebserkrankung reiche von pessimistischem Denken, über die realistische Einschätzung der Betroffenen in Bezug auf die Behandlungsmöglichkeiten und -risiken bis hin zu einer (allzu) positiven Einschätzung, welche dann oft auch enttäuscht werde, sagte Adrian Dubs. «Wir bieten unseren Patientinnen und Patienten ein Advance Care Planning (ACP) an. Mit dieser vorausschauenden Planung kommt der realistischen Einschätzung der Lebenssituation eine grosse Bedeutung zu.»
Die beiden Referenten plädierten für einen «angemessenen» Umgang mit Krebspatienten, da sich Ereignisse und Diagnosen häufig überstürzten. Ruedi Schweizer: «Die Erstdiagnose ist für viele ein Sturz aus der normalen Wirklichkeit. Oft folgen weitere, meist nicht vorhersehbare Stürze. Mit diesen Unwägbarkeiten umzugehen ist anspruchsvoll. Einigen Betroffenen gelingt es, die Krisen für eine Neubewertung nutzbar zu machen. Aus psychoonkologischer Sicht ist es zentral, nicht von gutem und schlechtem Coping zu sprechen, sondern Betroffene mit ihren jeweiligen Möglichkeiten zu begleiten und zu unterstützen.»
Zum Schluss der Veranstaltung referierte Prof. Dr. med. Gregor Hasler, Professor an der Universität Freiburg, über die Herausforderung «Gemeinsam Stress und Ängste überwinden». In den letzten Jahrzenten habe der gefühlte Stress in breiten Teilen der Bevölkerung zugenommen. Diese Zunahme betreffe die gesamte Gesellschaft und könne daher nicht allein durch persönliche oder individuelle Faktoren erklärt werden. Vielmehr seien soziale und kulturelle Faktoren mitverantwortlich, so Gregor Hasler in seinem Referat. «Deshalb können wir den Stress nicht rein individuell bewältigen, sondern müssen ihn gemeinsam angehen.»
Gregor Hasler wies auch auf die Bedeutung der sozialen Netzwerke in Bezug auf Stress hin. Ökonomen und Soziologen lobten die sogenannten weak ties, also die schwachen Bindungen, die unkompliziert, digital, wenig aufwendig und über weite Distanzen möglich seien. «Solche Beziehungen helfen uns, neue Ideen zu generieren, an ungewöhnliche Informationen zu gelangen und neue Produkte zu erfinden», sagte Hasler. Weak ties verbänden Abteilungen und Firmen, daraus könne neue Zusammenarbeit entstehen. Der Psychiater und Neurowissenschaftler wies aber auch auf problematische Seiten hin: «Die Resilienz-Forschung zeigt, dass solche schwachen Beziehungen keine Stress-Puffer sind und den sozialen Austausch nicht ersetzen können. Zudem stärken strong ties, also regelmässige und intensive Beziehungen, die Widerstandskraft nur dann, wenn sie lokal verankert sind.» Die Zeit, die wir in weak ties investierten, gehe bei den local ties verloren. «Dies ist ein entscheidender Treiber der aktuellen Resilienz-Krise.» Am Schluss seines Referates plädierte Gregor Hasler für weniger rücksichtslose Kompetition und mehr kooperative Beziehungen.
Die Teilnehmenden des Symposiums kamen nicht nur in den Genuss von spannenden Referaten, sondern auch von einer grossartigen künstlerischen Darbietung. Die musikalischen Intermezzi boten Mila Krasnyuk (Bratsche) und Schih Yu Tang (Flügel) dar.
Bitte klicken Sie auf die Namen der Referenten, um zum jeweiligen Vortrag zu gelangen.